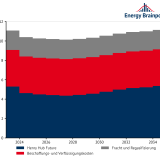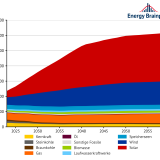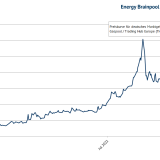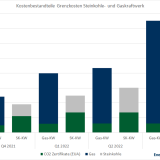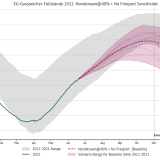Inmitten deutscher Hightech-Laboren entstehen bedeutende wissenschaftliche Innovationen. Sie werden, zusammen mit deutschen Chemieprodukten, in die ganze Welt exportiert werden. Die Wirkung von chemisch-pharmazeutischen Produkten reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Allerdings geht ihre Produktion nicht nur mit wirtschaftlichem Gewinn einher, sondern auch mit einem enormen Verbrauch an Energie und Ressourcen. Eine wesentliche Frage lautet daher: Wie können Klimaneutralität und die Chemiebranche miteinander vereinbart werden?
Artikel lesen »